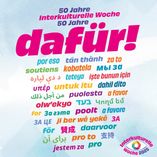Als Staatsminister Thomas Schmidt Mitte April die Stadtwerke Weißwasser (SWW) besuchte, hatte er einen Förderbescheid über 3,1 Millionen Euro dabei. Das Geld gab’s für das Projekt » AQVA Heat« , mit dem ein neues Verfahren erprobt werden soll, das Gewässer wie die Mandau in Zittau und den Ziegeleiteich in Weißwasser als Wärmequelle nutzt.
Federführend ist das Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik (IPM) der Hochschule Zittau/Görlitz. Im Rahmen eines Verbundprojekts mit dem Institut für Luft- und Kältetechnik Dresden und der BTU Cottbus-Senftenberg konnten bereits Erkenntnisse gewonnen und ein erster Prototyp getestet werden.
Im Zentrum der Technik steht ein sogenannter Vakuumflüssigeiserzeuger. In dem wird Wasser im Vakuum verdampft. Anders als bei normalem Umgebungsdruck etwa in unserer Küche geschieht das dort bei etwa -0,5 Grad Celsius, nicht erst bei 100 Grad. Der Vorgang entzieht der umgebenden Flüssigkeit Energie. Es entstehen Wasserdampf und Flüssigeis. Ersterer wird dann kondensiert. Dabei wird Wärme frei. Letzteres kann als Kältespeicher etwa für Gebäudeklimatisierung oder Prozesskühlung in der Industrie genutzt werden. Denn Flüssigeis ist pumpbar. »Es gibt viele Wärmepumpenprozesse, die bereits an Gewässern eingesetzt werden«, sagt Thomas Gubsch. Er ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am IPM. Aber die haben genau dann, wenn die meiste Wärme benötigt wird, ein Problem: Zu der Zeit ist das Wasser auch am kühlsten, lässt sich kaum noch abkühlen, ohne das Vereisungseffekte an den Wärmetauschern entstehen. Im Vakuumflüssigeiserzeuger ist das Eis gewollt, der Prozess funktioniert auch bei Wassertemperaturen knapp über 0 Grad.
Schnell kommt die Frage auf: Wie wirkt sich das auf die Gewässer aus? Das ist einer der Punkte, die jetzt in der zweiten Phase des Projekts über ein Monitoring genauer untersucht werden. Das zur Wärmeversorgung die Mandau oder der Ziegeleiteich leergesaugt werden, braucht man aber nicht zu fürchten. »Selbst wenn die Mandau im Sommer nach langer Trockenheit den Minimalwasserstand hat, brauchen wir bei Volllast weniger als ein Prozent des Durchflusses«, erklärt Thomas Gubsch. Und das Wasser wird nach der Abkühlung wieder in das Gewässer eingeleitet.
Der im Pilotprojekt gebaute Vakuumflüssigeiserzeuger hat einen Durchmesser von rund zwei Metern und eine Höhe von rund drei Metern. Damit können 500 kW thermische Leistung erzeugt werden. Als Vergleichsgröße: Ein modernes Einfamilienhaus hat einen Bedarf von rund 15 kW (natürlich hängt das von vielen Faktoren ab und die Zahl ist sehr verallgemeinert, sie hilft aber, sich eine grobe Leistungsfähigkeit des Prototyps vorzustellen).
Mit den Fördermitteln aus dem Strukturwandeltopf geht das Projekt jetzt in die zweite Phase. Die Pilotanlage in Zittau könnte noch dieses Jahr entstehen, weil die wasserrechtliche Genehmigung schon vorliegt. In Weißwasser wird wohl erst 2024 gebaut, weil hier die Genehmigung noch fehlt. In der Glasmacherstadt will man mit der Testanlage das Gebäude der Stadtwerke beheizen, in Zittau wird die Wärme ins Fernwärmenetz gespeist. Ziel ist es, die Anlagentechnik weiterzuentwickeln und damit die Leistung zu erhöhen. »Das ist keine Technik, die für ein einzelnes Eigenheim zur Anwendung kommen wird. Es muss schon immer zumindest ein kleines Netz sein«, sagt Thomas Gubsch. Und es wird auch nicht als einziges System die Nutzung der Abwärme aus Kohlekraftwerken ersetzen können. Aber es könnte ein Baustein dafür sein.