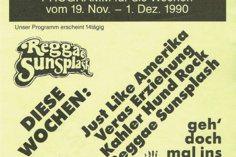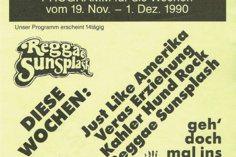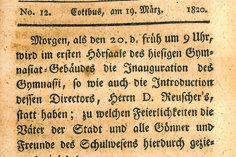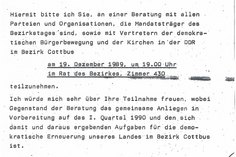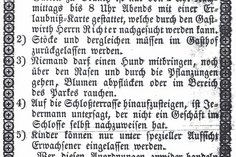Die WochenKurier-Kolumne von Dr. Peter Lewandrowski
In heutiger Zeit erscheinen regelmäßig Rankinglisten zum Wohnwert der Städte. Die Umfrage von 2016 sah mit München, Erlangen und Ingolstadt drei bayrische Kommunen vorn. Gemessen wurden Lebensqualität, Wohn- und Arbeitsbedingungen und die Zukunftschancen in den Städten. In der DDR gab es solche Umfragen offiziell natürlich nicht. Inoffiziell gab es den Vergleich der Lebensqualität der Städte schon. Und das entscheidende Kriterium war damals folgendes: Wie lange musste man auf eine Neubauwohnung warten? Diese Frage beeinflusste Berufs- und Studienwünsche, sorgte für Bevölkerungszuwachs in eher unwirtlichen Gebieten und brachte die Arbeitskräfte zu den Großbaustellen. Die Neubauwohnung war das Ziel der Wünsche, Q3A, P 2 oder WBS 70.
Der SED-Führung war immer bewusst, dass die Lösung der Wohnungsfrage eine überragende Bedeutung besaß. Das Heinrich-Zille-Zitat: „Man kann einen Menschen mit einer Axt erschlagen, man kann ihn aber auch mit einer Wohnung erschlagen“, zugeschnitten auf die Berliner Arbeiterviertel in der Kaiserzeit, traf auf Cottbus in den Fünfzigern durchaus zu. Durch Kriegshandlungen waren 356 Häuser vollständig zerstört und 3600 Wohnungen beschädigt. Zu den 13.000 obdachlosen Cottbusern kamen Tausende Flüchtlinge aus den ehemaligen Ostgebieten. Was man in Cottbus brauchte, waren Wohnungen und nochmals Wohnungen. Durch die Ernennung zur Bezirksstadt und dem Ausbau zum Zentrum der Kohle- und Energiewirtschaft gewann diese Aufgabe noch an Gewicht. Die große Nachfrage konnte nur durch die Verwendung von Betonfertigteilen befriedigt werden. Nachdem in den Fünfziger Jahren zunächst an Einzelstandorten gebaut wurde bzw. Lückenschließungen erfolgten, entstanden ab den Sechzigern die Großsiedlungen, ab 1960 Sandow, ab 1972 Ströbitz, ab 1975 Sachsendorf und ab 1983 Schmellwitz.
Den entscheidenden Wendepunkt für den Wohnungsbau im Bezirk gab es Anfang des Jahres 1967. Der von Projektierungsbüros in Halle und Cottbus entworfene Plattenbautyp „IW 66 P2“, kurz P 2 genannt, soll an den Standorten Cottbus, Lübbenau und Hoyerswerda eingeführt werden. Dazu nahm das neue Plattenwerk an der Peitzer Straße am 2. Januar 1967, vor 50 Jahren, seinen Betrieb auf. „Betonplattenwerk für Wohnungen am Fließband“ titelte die Lausitzer Rundschau. Hans Schmidt, damals Vorsitzender des Rates des Bezirks, sagte zum Produktionsbeginn, dass nun ein „... weiterer bedeutender Schritt zur Industrialisierung im Wohnungsbau getan ...“ wurde. „Nach der vollen Inbetriebnahme wird das Werk jährlich Fertigteile zum Bau von1200 kompletten Wohnungen herstellen.“ Für die nächsten zwei Jahrzehnte gehörten die Sattelschlepper mit den Wänden, Decken oder komplett montierten Badzellen zum Straßenbild von Cottbus. In der Stadt, so konstatierte eine Infobroschüre 1988, entstanden seit DDR-Gründung 45.131 Wohnungen, davon 41.113 durch Neubau. Über 4000 wurden modernisiert. Und um das besondere Bautempo der Honecker-Ära hervorzuheben, erwähnte die Broschüre, dass von den 45.000 Cottbuser Wohnungen 31.000 aus der Zeit seit 1971 stammten. Der Generalsekretär stellte das Wohnungsbauprogramm dann auch in den Mittelpunkt des Parteitagsberichts 1986: „In 15 Jahren entstanden 2,4 Millionen neu gebaute und modernisierte Wohnungen, wodurch die Wohnbedingungen für 7,2 Millionen Bürger verbessert werden konnten.“
Über den DDR-Plattenbau ist seither viel gesagt worden. Mitunter wurde dabei vergessen, dass in Köln, Paris und Kairo ebenfalls so gebaut wurde. Da nahezu alle Menschen über Dreißig im Osten Deutschlands Erfahrungen mit den Wohnungen im Plattenbau haben, gibt es ausreichend eigene Urteile. Der wohl größte Nachteil war sicherlich die Uniformität. Beim Betrachten eines Fotos einer Großsiedlung in Plattenbauweise ist nicht leicht zu erkennen, ob es sich um Cottbus-Sachsendorf, die Neubrandenburger Oststadt oder Halle/Neustadt handelt. Ja, auch Lipezk, Ulan Bator oder eine Siedlung an der Erdgastrasse kämen in Frage. Über den egalitären Aspekt gibt es sicherlich unterschiedliche Ansichten. In den Sandower Wohnblöcken lebten der Generaldirektor des großen Kombinats, der Lehrer und der Hilfsarbeiter zusammen. Die Ärztin machte am Wochenende die Hausordnung. Die draußen spielenden Kinder nutzten die Toilette des Rentnerehepaares im Erdgeschoss. Und das Cottbuser Mitglied der obersten Parteiführung ging von seiner kleinen Neubauwohnung in der Finsterwalder Straße zu Fuß in das große Haus in der Bahnhofstraße, allerdings gefolgt von seinem Volvo mit Leibwächter. Eigenheime gab es in den größeren Städten, wenn überhaupt und in der nachfolgenden Reihenfolge, nur für Kinderreiche, Künstler und Ärzte. Diejenigen, die unter den Gleichen etwas gleicher waren, hatten dann neben der P 2-Wohnung noch eine Datsche in Lamsfeld oder Pinnow.
Von den 45.000 Cottbuser Neubauwohnungen sind noch 35.000 übrig geblieben. Über 10.000 wurden (neudeutsch) „zurückgebaut“. Etliche Modernisierungslösungen in Cottbus zeigen, dass man auch heute im Plattenbau gut wohnen kann.